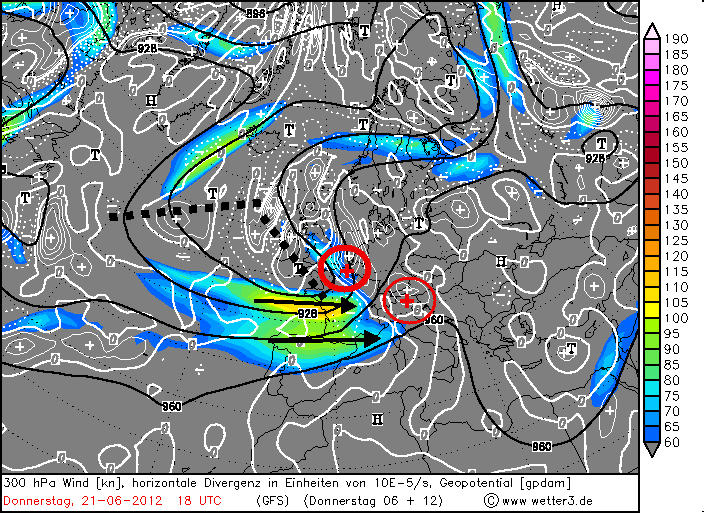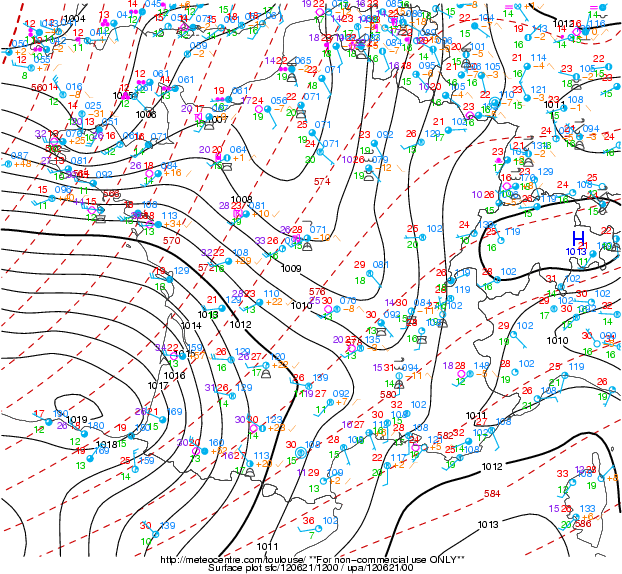nordspot hat geschrieben:@ Stefan: Kannst du mir bitte erklären was es mit diesen eingelagerten Trockenschichten auf sich hat und wie die sich auf die Gewitterentwicklung auswirken

Die Luft oberhalb der feuchten Grundschicht ist bis am Mittag bis etwa 5000m hoch recht trocken gewesen. Die Trockenheit wird jetzt aber zunehmend abgebaut.
Sofern die trockenen Schichten nicht zu dick sind, können sie Konvektion fördern. Sind sie aber zu mächtig, wie heute bis Mittag, dann wird einsetzende Konvektion (Durchmischung) das Wolkenwachstum behindern. Wird in einen Cumulus trockene Randluft eingemischt, trocknet dieser schneller wieder ab. -> Die kondensierte warme Wolkenluft im Cumulus kühlt von außen nach innen ab, bedingt durch Energieverbrauch durch Verdunstung. Klar, denn Wolke = Wasser und je trockener die eingemischte Luft, umso stärker Verdunstung = Abkühlung. Sofern es labil genug ist, wird aber stets der Cumulus warm gehalten, denn Aufwind + Kondensation = warme Wolkenluft. Ist dann immer eine Rechnung, ob die Abtrocknung durch Verdunstung oder die Erwärmung im Cumulus durch Kondensation überwiegt.
Übrigens: Föhn = Kumulierung von Feuchte am Alpenrand (Föhnbise + Alpines Pumpen) Föhn = Generierung von viel trockener Luft. Da wo es passt, eine explosive Mischung. Die besten Zellen mit hohem Superzellenfaktor an den Voralpen entstehen im Föhngrenzbereich. Napf und Pilatus sind da bei Euch glaub begünstigte Gebiete?
Der Weg zu Gewittern ist oft weit, wenn Trockenschichten vertikal sind zu breit. Dann schaukelt sich die Feuchtekonvektiion nur langsam hoch. Manchmal äußerst sich das in besonders hohe Cumulus (Towering Cumulus = Turkey Towers) die auf dem Weg gen Himmel gemütlich abtrocknen. Daher kommt es so gut wie nie zur Gewitteraulöse (Initialisierung) aus einem einzelnen Cumulus, sondern durch Organisation (oder Kumulierung) viele einzelner Cumulus zu einem Cu med und Cu con. Heute wird es präfrontal sowas geben können, denn labil genug ist es und die Trockenschicht wird immer feuchter. Denn: Irgendwohin muss die Grundschichtfeuchte ja hin. Wohin, wenn nicht mit einem Cu vertikal transporiert? Erst vertikal transportiert, kondensiert und später vom Chaser konsumiert in flüßiger, manchmal festem Aggregatszustand

Je größer der Cu, umso weniger führren Abkühlungsvorgänge am Wolkenrand zum Abtrocknen eines Cumulus. Daher kann die Verdunstungsabkühlung am Wolkenrand selbst für Verstärkung der Konvektion sorgen, denn der Temperatgradient zwischen der abkühenden Wolkenrandluft und warmen konensierten Wolkenluft nimmt zu, die Konvektion verstärkt sich. Zu breit dürfen die Schichten halt nicht sein und zu stabil sollte es auch nicht sein. Ist es das -> Schönwettercumuli die entstehen und versiegen, sich bestenfalls stationär regenerieren. Der Idealzustand für Thermiksportler. Zu stabil für Gewitter, ausreichend trocken-labil durch (überadiabatisch Bodenerwärmung) für stete Thermikentwicklung (Feuchtekonvektion) mit aufgesetztem Käppchen.
 Danke.
Danke.